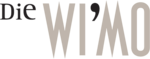Die unabhängige Organisation YEP – Stimme der Jugend hat in Kooperation mit dem Bildungsministerium den bisher größten Beteiligungsprozess für Jugendliche im Bildungsbereich gestartet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage: Wie soll der Lehrplan der Zukunft aussehen? Auch die 4CHW der WI’MO ist Teil dieser Initiative.
In einem Co-Creation-Workshop erhielten die Schüler*innen die Möglichkeit, ihre Ideen, Wünsche und Kritikpunkte aktiv einzubringen und so den neuen Lehrplan mitzugestalten. Geleitet wurde dieser Workshop von Samantha Tady, die die Schüler*innen mit klaren Worten motivierte: „Ihr seid die Expert*innen eures eigenen Lebens. Ihr könnt sagen, was euch am Lehrplan aktuell gefällt – also was beibehalten werden soll – und was euch fehlt. Eure Meinung verdient Gehör.“
Gleich zu Beginn beschäftigten sich die Schüler*innen mit einer grundlegenden Frage: Was bedeutet Demokratie? In einer kurzen Vorstellrunde formulierten sie ihre persönlichen Definitionen. Genannt wurden Begriffe wie: Gemeinschaft, Mitbestimmung, Mitspracherecht, Meinungsäußerung, Mitentscheidung, Pressefreiheit, Gleichheit, Freiheit sowie das Recht, über die eigene Zukunft entscheiden zu dürfen.
Position beziehen und diskutieren
Im Anschluss wurden von der Workshopleiterin verschiedene Statements vorgelesen, zu denen sich die Schüler*innen im Raum positionieren sollten – je nachdem, wie stark sie einer Aussage zustimmten. Dabei wurde deutlich: Die Jugendlichen haben klare Haltungen und reflektierte Meinungen.
Eine Frage lautete: Was ist für euch Allgemeinbildung? Und denkt ihr, ihr habt genug davon? Die Mehrheit war der Meinung, dass sie eine gute Mischung aus schultypspezifischer Bildung (HLW) und Allgemeinbildung erhalten. Deutlich wurde auch: „Theorie braucht Praxisbezug – sonst fehlt der Anknüpfungspunkt. Wenn die Theorie im Jänner besprochen wird, muss die Praxis gleich darauf folgen. Es bringt nichts, diese erst im Mai nachzuholen.“ Eine Einführung weiterer Theoriefächer stieß hingegen auf wenig Zustimmung.
Beim Thema Mitbestimmung im Unterricht gab es ein starkes Votum: „Ich möchte mitentscheiden, was ich lerne – aber es braucht einen Rahmen, der von Erwachsenen geschaffen wird. Sonst würden wichtige Inhalte untergehen, an die man als Schüler*in vielleicht noch nicht denkt“, meinte die Schülerin Alina Pototschnig. Herbert Wukoutz ergänzte: „Manche Wege lernt man nur kennen, wenn man sie gezeigt bekommt.“ Auch er sprach sich für Mitbestimmung innerhalb eines klaren Rahmens aus.
Zentrale Anliegen der Schüler*innen
Im Verlauf des Workshops kristallisierten sich mehrere zentrale Anliegen und Erwartungen heraus: Einerseits sehen sie sich durch die Praktika, Zusatzausbildungen und Zertifikate, die sie machen können, gut auf die Berufswelt vorbereitet. Andererseits äußerten sie den Wunsch nach mehr Freiheiten bei der Fächerwahl, besonders im kreativen und musikalischen Bereich, um ihren Interessen gezielt nachgehen zu können.
Besonders wichtig ist den Schüler*innen auch eine starke Verbindung zwischen Theorie und Praxis sowie ein fächerübergreifender Unterricht. Inhalte sollten nicht isoliert, sondern in thematischen Zusammenhängen vermittelt werden. „Wenn die Aufklärung in Geschichte und Politischer Bildung ein Thema ist, sollte sie beispielsweise auch im Deutschunterricht aufgegriffen werden. Oder wenn die EU in Geografie behandelt wird, braucht es die Verbindung zur Geschichte.“ Der Lehrplan, so der Wunsch, muss hier stärker auf Verknüpfungen achten.
Darüber hinaus betonten die Schüler*innen die Relevanz lebensnaher Bildung: Politische Bildung sollte vor der ersten Wahl stattfinden und auch grundlegendes Wissen rund um Miete, Mietverträge, Steuerausgleich und Wohnungskauf müsse Teil des Unterrichts sein – idealerweise bevor sie die Schule verlassen.
Reality Check: Schule heute – Schule morgen
Zum Abschluss des Workshops reflektierte die Schüler*innen in Kleingruppen vier Themenbereiche: Lehrpersonen, Unterricht, Schule als Lernort und HLW als Schulform. Dabei setzten sie sich intensiv mit der aktuellen Schulsituation auseinander, verglichen sie mit ihren persönlichen Idealvorstellungen und diskutierten. Der Austausch zeigte deutlich, an welchen Schrauben die Schule der Zukunft noch drehen muss.
Ziel des Workshops war es, Jugendlichen eine starke Stimme im Bildungsdiskurs zu geben. Und das ist gelungen: „Die Schüler*innen konnten ihre individuellen Meinungen souverän vertreten und jede einzelne war wertvoll“, betont Prof. Silke Sallinger, die den Workshop organisierte. „Besonders spannend war die Vielfalt der Perspektiven, die eingebracht wurden.“ Auch Samantha Tady zeigte sich begeistert: „Eine tolle Gruppe, mit der das Arbeiten große Freude gemacht hat.“